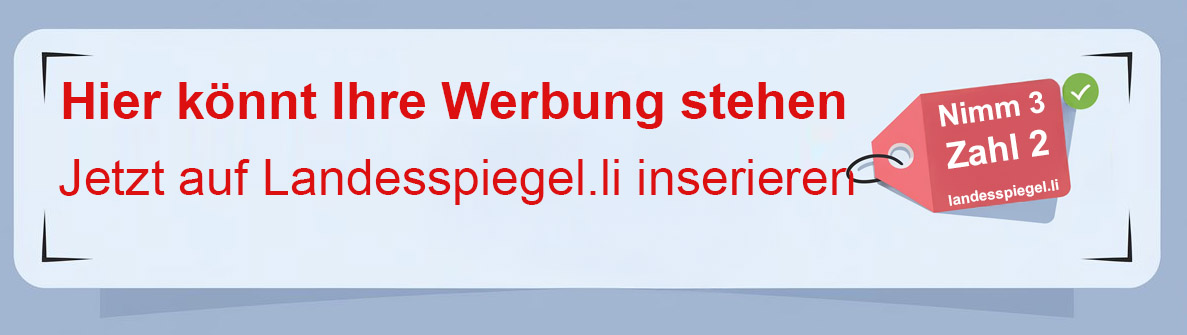Im Rahmen eines Vortrags am Liechtenstein-Institut präsentierte der Politologe Dr. Thomas Milic eine detaillierte Analyse der Wahllistenmodifikationen bei der Landtagswahl 2025. Dabei standen die sogenannten Sympathiestimmen oder Panaschierstimmen im Mittelpunkt – also jene Stimmen, die Wähler durch das Streichen und Hinzufügen von Kandidierenden über Parteigrenzen hinweg vergeben.
Milic zeigte auf, dass diese Modifikationen wertvolle Einblicke in das Wahlverhalten geben. Sie verdeutlichen nicht nur die Disziplin innerhalb der Parteien, sondern auch die Affinitäten der Wählerschaft zu bestimmten Personen oder politischen Gruppierungen.
Panaschierkönige: Wer überzeugt parteiübergreifend?
Besondere Aufmerksamkeit galt den Kandidatinnen und Kandidaten, die parteiübergreifend die meisten Stimmen sammeln konnten. Diese «Panaschierkönige» zeichnen sich durch eine hohe persönliche Beliebtheit aus, die über die klassische Parteizugehörigkeit hinausgeht.
„Die Sympathiestimmen basieren nicht zwingend auf ideologischer Nähe“, erklärte Milic. Vielmehr könnten sie auch Ausdruck einer allgemeinen Popularität oder persönlichen Integrität sein. Ein interessanter Vergleich zog er zur sogenannten «Bierfrage» in den USA, bei der untersucht wird, mit welchem Kandidaten die Wähler am ehesten ein Bier trinken würden – oft ein Indikator für Wahlerfolg.
Parteiübergreifende Affinitäten und parteiinterne Disziplin
Neben individuellen Beliebtheitswerten analysierte Milic auch parteiübergreifende Muster: Welche Parteien wurden besonders oft miteinander kombiniert? Welche Parteien profitierten am meisten von zugewanderten Stimmen, und welche Wählergruppen hielten sich strikt an die Vorgaben ihrer Partei?
Hier zeigte sich, dass einige Parteien eine höhere Disziplin ihrer Wählerschaft aufweisen als andere. Besonders auffällig war der Rückgang der veränderten Wahlzettel bei der DpL, was darauf hindeutet, dass ihre Anhängerschaft die Wahlliste stärker unverändert eingereicht hat. In den 1970er Jahren lag der Anteil veränderter Wahlzettel bei nur 20–25 %, während er 2025 bei einigen Parteien auf über 60 % angestiegen ist – ein klares Zeichen für die zunehmende Individualisierung des Wahlverhaltens. Milic führt dies aber auch darauf zurück, dass es heute mehre Parteien gibt.
Ein weiteres bemerkenswertes Detail: Die Wahlzettel der VU und der FBP zeigten jeweils zwischen 10 und 12 Prozent an zusätzlichen Stimmen aus veränderten Wahlzetteln. Besonders interessant war der hohe Anteil an ersatzlosen Streichungen. Dies deutet darauf hin, dass bestimmte Kandidierende innerhalb dieser Parteien auf deutliche Ablehnung gestossen sind. Während man bei der DpL und der FL keine exakten Werte angeben konnte, war bei FBP und VU ein klarer Trend erkennbar. Würde man diese Werte auf Wahlzettel umrechnen, wären die Anteile sogar noch höher.
Welche Bedeutung haben Sympathiestimmen?
Abschliessend stellte Milic die Frage nach der politischen Relevanz dieser Modifikationen. Zwar hätten Sympathiestimmen allein in der Vergangenheit keine Wahlergebnisse entschieden, doch in knappen Rennen könnten sie das Zünglein an der Waage sein. In der diesjährigen Wahl konnte die FBP viele Panaschierstimmen für sich gewinnen, was auf eine hohe individuelle Attraktivität ihrer Kandidierenden hinweist. Dennoch reichte es nicht für einen Wahlerfolg, was darauf hindeutet, dass andere Faktoren, etwa parteipolitische Strategien, eine grössere Rolle spielten.
Die detaillierten statistischen Auswertungen von Milic lieferten wertvolle Erkenntnisse über das Wahlverhalten der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner und werfen spannende Fragen für zukünftige Wahlen auf.