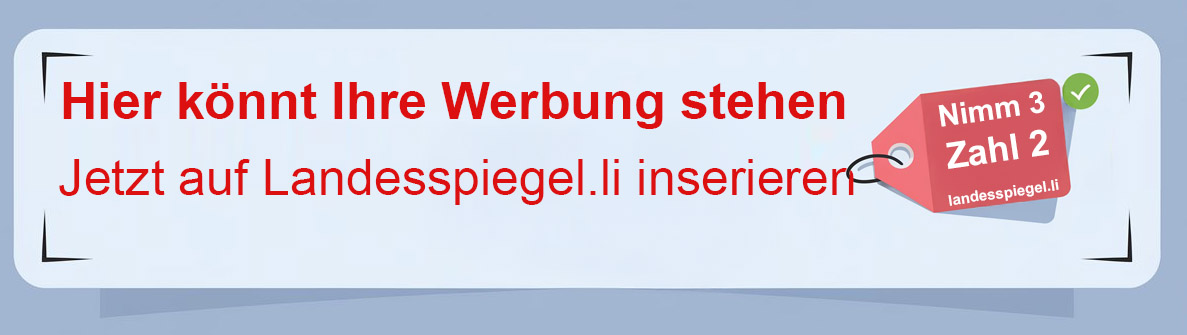Wie funktioniert der «Doppelte Pukelsheim» – und weshalb sorgt er derzeit in Liechtenstein für Diskussionen? Diesen Fragen widmete sich am Donnerstagabend eine öffentliche Veranstaltung im Vereinshaus Gamprin-Bendern. Gastgeber war das Liechtenstein-Institut. Der Politikwissenschafter Thomas Milic führte durch das Gespräch mit Friedrich Pukelsheim, dem Mathematiker, dessen Name heute mit dem Verfahren verknüpft wird.
Hintergrund des grossen Interesses ist die Volksinitiative der Jungen FBP. Sie will das Verfahren für die Landtagswahlen einführen. Der Landtag befasst sich voraussichtlich im Dezember damit. Kommt es zu keiner Einigung, entscheidet das Stimmvolk – wohl im Februar 2026.
Warum dieses Verfahren überhaupt existiert
Der «Doppelte Pukelsheim», von seinem Erfinder eigentlich Doppelproporz bezeichnet, beruht auf einem Divisorverfahren mit Standardrundung. Es soll sicherstellen, dass Stimmenanteile und Sitzanteile möglichst deckungsgleich sind. In der Schweiz fand das System ab 2006 Verbreitung. Auslöser war ein Entscheid des Bundesgerichts, das in mehreren Kantonen die Wahlgleichheit verletzt sah. Kleine Wahlkreise führten dort dazu, dass Parteien trotz zweistelliger Stimmenanteile ohne Mandat blieben.
Friedrich Pukelsheim schilderte an diesem Abend, wie er damals in Zürich als Experte beigezogen wurde. Entscheidend sei die Frage gewesen, wie man Stimmen fair in Sitze umrechnet. Zentral sei dabei der Erfolgswert jeder einzelnen Stimme – ein Prinzip, das in mehreren europäischen Ländern unterschiedlich interpretiert werde. Der Doppelproporz orientiert sich dabei an einem sehr strengen Verständnis von Gleichheit.
Zwei Ebenen, ein Ergebnis
Das Verfahren kombiniert zwei Berechnungen. Zuerst werden alle Stimmen auf Landesebene zusammengeführt. Daraus ergibt sich, wie viele Sitze jede Partei insgesamt erhält. Danach folgt die Verteilung auf die Wahlkreise. Damit sowohl die parteilichen Gesamtsitze als auch die fixen Sitzkontingente der Wahlkreise eingehalten werden, kommen zwei Divisoren zum Einsatz. Die Wahlleitung müsste sie bekanntgeben – erst damit wird das Ergebnis für alle nachrechenbar.
Panaschieren bleibt möglich. Da Stimmen im Ober- und Unterland unterschiedlich viele Wertungen erlauben, berechnet das System vorab eine einheitliche Wählerzahl pro Partei. Das führt zu Zwischenwerten mit Dezimalstellen, verändert aber die Stimmabgabe nicht.
Was das Verfahren kann – und was nicht
Paradoxien, wie sie bei gewissen anderen Zuteilungsverfahren auftreten, schliesst der Doppelproporz weitgehend aus. Das Ergebnis ist eindeutig, auch wenn der Weg zur Berechnung nicht nur einen, sondern mehrere mögliche Rechenwege kennt. Entscheidend ist nur, dass am Ende alle Vorgaben erfüllt werden.
Fragen aus dem Publikum richteten sich vor allem darauf, ob das System für Liechtenstein überhaupt nötig wäre. Die Probleme sehr kleiner Wahlkreise, die in der Schweiz eine grosse Rolle spielten, bestehen hier nicht. Listenverbindungen kennt Liechtenstein ebenfalls nicht. Für die Initiative ist deshalb vor allem ein Punkt entscheidend: Soll jede Stimme im ganzen Land gleich viel zählen – unabhängig vom Wahlkreis? Oder soll die bestehende Wahlkreisidentität weiterhin Vorrang haben?
Ein aufschlussreicher Abend
Der Abend machte deutlich, wie sehr Wahlsysteme politische Grundentscheidungen widerspiegeln. Der Doppelproporz bietet rechnerische Präzision und eine sehr gleichmässige Erfolgswertverteilung. Ob diese Form der Gleichheit in Liechtenstein gewünscht ist, wird nun in Politik und Öffentlichkeit diskutiert.