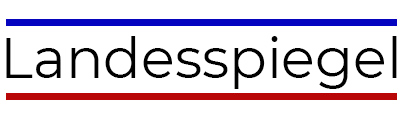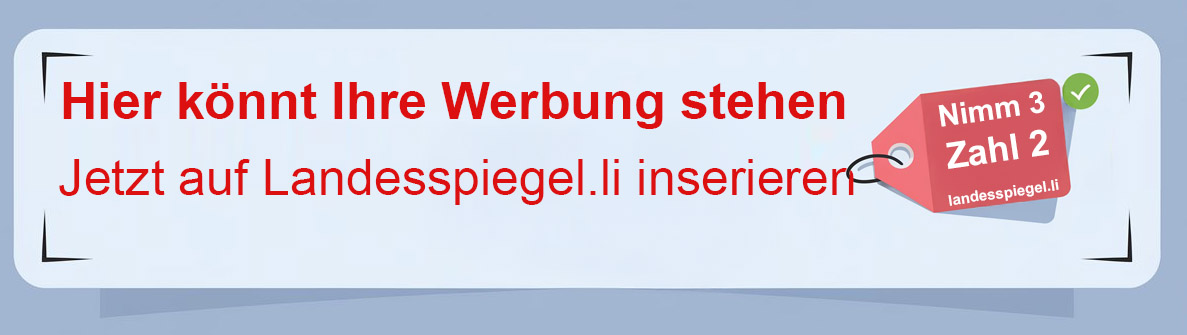Schweizer KI-Modell ist online – Es spricht Schweizerdeutsch

Während Google, OpenAI und Meta ihre künstlichen Intelligenzen wie Staatsgeheimnisse behandeln, machen Schweizer Forscher das Gegenteil: Sie verschenken ihre neueste Entwicklung an die Welt.
Apertus heisst das Geschenk aus den Labors von EPFL, ETH Zürich und dem Supercomputing-Zentrum CSCS. Der Name ist Programm – lateinisch für «offen». Doch hinter diesem schlichten Wort verbirgt sich eine Kampfansage an die Monopole im Silicon Valley.
Seit Montag kann jeder das Sprachmodell herunterladen, zerlegen und für eigene Zwecke nutzen. Kostenlos. Ohne Haken. Das ist in der KI-Welt so ungewöhnlich wie ein Autohersteller, der seine Baupläne verschenkt. «Wir wollen zeigen, dass KI nicht in den Händen weniger Tech-Konzerne bleiben muss», sagt Martin Jaggi von der EPFL. Seine Worte klingen wie eine Kriegserklärung an die Datenkraken aus Kalifornien.
Doch Apertus ist mehr als ein politisches Statement. Das System beherrscht über 1000 Sprachen – und hier wird es für uns besonders interessant. Während ChatGPT und Co. hauptsächlich Englisch sprechen, plaudert Apertus munter auf Schweizerdeutsch, Rätoromanisch oder Liechtensteiner Dialekt.
Ein Schweizer KI-System, das «Grüezi» sagt statt «Hello» – das ist keine Spielerei, sondern strategisch klug. Denn wer will schon eine künstliche Intelligenz, die unsere Mundart nicht versteht? Die Zahlen beeindrucken: 15 Billionen Wörter aus über 1000 Sprachen flossen in das Training. 40 Prozent davon nicht auf Englisch. Zum Vergleich: Die meisten US-amerikanischen Systeme sind sprachliche Einbahnstrassen.
«Apertus wurde als Beitrag zum Gemeinwohl entwickelt», erklärt Imanol Schlag von der ETH Zürich. Gemeinwohl – ein Wort, das in den Boardrooms von Meta oder Google seltener fällt als Schneeflocken im Juli.
Während andere Konzerne ihre KI-Modelle hinter Bezahlschranken verstecken, stellen die Schweizer alles ins Internet: Den Programmcode, die Trainingsdaten, sogar die Zwischenschritte der Entwicklung. Ein gläsernes Labor für die Welt. Thomas Schulthess vom CSCS nennt es «Impulsgeber für Innovationen». Übersetzt heisst das: Während die Grossen ihre Geheimnisse horten, schaffen die Schweizer die Basis für tausende neue Ideen.
Lage und teuer Entwicklung
Die Entwicklung kostete Millionen – nicht in Franken, sondern in Rechenstunden. Über 10 Millionen GPU-Stunden rechnete der Supercomputer Alps. Das entspricht etwa 1000 Jahren normaler Computerarbeit. Doch der wahre Wert liegt nicht in den Kosten, sondern in der Philosophie. Während Silicon Valley auf Geheimhaltung setzt, wählen die Schweizer den Weg der Transparenz. Ein David gegen Goliath – mit Grüezi statt Kriegsgeschrei.
Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Schweizer Strategie aufgeht. Bei den Swiss-AI-Weeks können Entwickler das System erstmals richtig testen. Ihre Reaktionen werden entscheiden, ob Apertus nur ein schönes Experiment bleibt oder zur echten Alternative wird. «Die Veröffentlichung ist kein Endpunkt, sondern der Beginn einer Reise», prophezeit Antoine Bosselut von der EPFL. Eine Reise, die zeigen könnte, dass nicht immer der Grösste gewinnt – manchmal reicht es, der Ehrlichste zu sein.