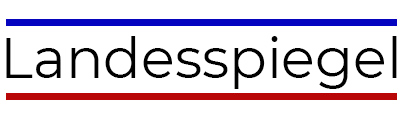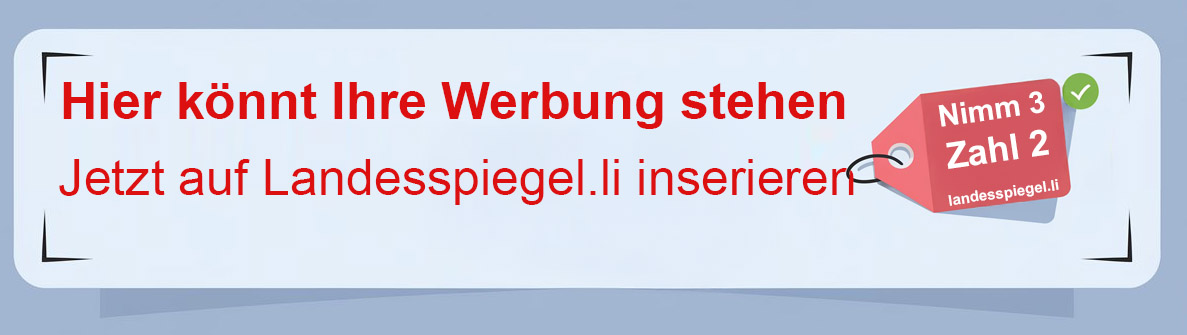IWF-Quotenerhöhung sorgt für lange Debatte

Bis in die Abendstunden hat der Landtag hat über die Erhöhung der Quote beim Internationalen Währungsfonds beraten. Die Regierung beantragt, die Quote von 100 auf 150 Millionen Sonderziehungsrechte anzuheben. Stefan Öhri (VU) warb für die Quotenerhöhung. Er betont, dass Liechtenstein damit sein Recht aus dem Beitritt ausübt. Die 50 Millionen Sonderziehungsrechte entsprechen rund 56 Millionen Franken. Davon fliessen 12,5 Millionen als verzinsliche Reserve zum IWF. Der Rest wird als Schuldurkunde bei der Schweizerischen Nationalbank hinterlegt.
Öhri erklärt die Bedeutung der Quote. Sie bestimmt den finanziellen Beitrag, das Stimmrecht und die Kreditmöglichkeiten eines Landes. Die Reserve kann jederzeit liquidiert werden. Liechtenstein stärkt damit den Zugriff auf internationale Liquidität. Das Land hat keine eigene Notenbank. Der IWF dient als Kreditgeber letzter Instanz.
Die Alternative wäre ein Verzicht. Nur Syrien und Eritrea haben bei der letzten Quotenrunde nicht teilgenommen. Öhri fragt, ob Liechtenstein im Team dieser Länder oder im Team der Schweiz mitspielen will.
Roger Schädler (VU) unterstützt die Vorlage. Die Quotenanpassung biete die Gelegenheit, das Land breiter und krisenfester aufzustellen. In einer Welt mit zunehmenden Spannungen sei es zentral, in multilateralen Institutionen vertreten zu bleiben. Die Quotenerhöhung leiste einen substanziellen Beitrag zur Funktionsfähigkeit des IWF.
Ablehnend äusserte sich Johannes Kaiser (FBP), der bereits im Abstimmungskampf gegen den Beitritt zum IWF eingetreten war. Er sieht die Quotenerhöhung als symbolische Geste mit fraglichem Nutzen. Kaiser kritisiert das Währungsrisiko. Die im Sonderziehungsrechte-Korb enthaltenen Währungen seien schwächer als der Schweizer Franken. Er fordert, dass Liechtenstein für die Menschen und die Wirtschaft im Land investiert.
Die 17. Quotenüberprüfung werde im Bericht nicht erwähnt, bemängelt Kaiser. Diese sei bis 2028 geplant und bringe weitere Anpassungen. Er warnt vor hohen Kreditkosten bei Naturkatastrophen. Strukturanpassungen würden wichtige Errungenschaften im Sozial- und Gesundheitswesen schmälern.
Auch Patrick Risch (FL) sieht die Quotenerhöhung kritisch. Er bezeichnet sie als Prestigeversicherung. Liechtenstein verfügt über stabile Finanzen und keine Staatsverschuldung. Die Wahrscheinlichkeit, auf IWF-Kredite angewiesen zu sein, sei gering. Risch fordert, das Geld besser im Inland zu investieren. Investitionen in Bildung, Gesundheit und Jugendförderung hätten höhere Renditen. Er lehnt die Quotenerhöhung ab.
Die Quotenerhöhung kommt für Thomas Rehak (DpL) zu schnell nach dem Beitritt. Das Volk habe im September 2024 mit 55,8 Prozent für den IWF-Beitritt gestimmt. Das Verständnis für die Quotenerhöhung sei in der Bevölkerung kaum vorhanden. Rehak fragt, warum ein Verzicht dem Ansehen Liechtensteins schaden würde. Die Schweiz habe einstimmig zugestimmt. Das sei ein starkes Zeichen.
Diese Argumentation teilt auch Manuela Haldner-Schierscher (FL). Der Antrag erfolge zu früh nach dem Beitritt. Dies könnte den Eindruck vermitteln, dass zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht vollumfänglich informiert wurde. Sie möchte Fortschritte sehen, dass der IWF Menschenrechte respektiert und auf Transparenz setzt. Nachhaltigkeit bedeute nicht nur die Stärkung internationaler Finanzinstitutionen. Liechtenstein sollte mit seinen Mitteln einen Zukunftsfonds aufbauen.
Martin Seger (DpL) lehnt die Quotenerhöhung ab. Die Teilnahme sei freiwillig. Liechtenstein bleibe auch ohne Erhöhung vollwertiges Mitglied. Seger kritisiert, dass der Staat Risiken versichert, die im Bankensektor entstehen. Die Versicherung zahle nicht die Finanzbranche, sondern der Steuerzahler. Die Banken erzielten 2024 einen Gesamtgewinn von 440 Millionen Franken. Sie müssten sich überproportional an der Quotenerhöhung beteiligen.
Anders als ihr Fraktionssprecher unterstützt Bettina Petzold-Mähr (FBP) die Erhöhung. Die 16. Quotenüberprüfung war zum Zeitpunkt des Beitritts bekannt. Niemand könne behaupten, dies komme überraschend. In dieser komplexen Thematik werde versucht, mit emotionalen Argumenten die Einwohner zu bewegen. Die Quotenerhöhung erweitere die Sicherheits- und Stabilitätspolitik. Im Krisenfall könne der IWF als Rettungsschirm zur Seite stehen.
Christoph Wenaweser (VU) betont die Bedeutung der Schweiz. Liechtenstein müsse im Gleichschritt mit seinem wichtigsten Partner weitergehen. Die Schweiz präsentiert die Helvetistan-Gruppe im IWF. Der Nationalrat habe mit 187 zu null Stimmen zugestimmt. Der Ständerat folgte mit 38 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme.
Sie hat vor einem Jahr gegen den IWF-Beitritt gestimmt, sagte Marion Kindle-Kühnis (DpL). Knapp ein Jahr später werde schon wieder über das umstrittene Thema diskutiert. Sie kritisiert, dass die Regierung den Gesamtbetrag nicht in Franken nennt. Das Wort fiktiv für Sonderziehungsrechte stimme nicht, korrigiert die Regierung später. Kindle-Kühnis sieht die Quotenerhöhung als Reserve für schlechte Zeiten. Sie würde aber die Verschiebung auf ein Sperrkonto im Inland vorziehen. Das Geld wäre bei uns, egal wie sich die Welt entwickelt. Sie fragt, ob Liechtenstein bei einer globalen Krise praktisch keine Mittel erhalten würde. Der Anteil liege bei nur 0,02 Prozent.
Ausführungen der Regierung

Regierungschefin Brigitte Haas verteidigt die Vorlage. Es gehe darum, einen Sparbeitrag von einem Sparbuch auf ein anderes zu verschieben. Das Geld werde nicht ausgegeben. Die Einlage gehöre weiterhin Liechtenstein und sei jederzeit abrufbar. Die 14,5 Millionen Franken würden aus dem Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen verschoben. Das Landesvermögen verändere sich nicht.
Haas betont die Bedeutung für die Stabilität. Mit einer höheren Quote verbessere sich der Rettungsschirm. In Krisensituationen brauche es rasches Geld. Die Quote werde als Multiplikator genutzt. Island habe bei der Bankenkrise die Quote mal zwölf erhalten. Das Land habe in sieben Jahren alles zurückzahlen können.
Die Quotenerhöhung stärke auch das AAA-Rating. Rating-Agenturen würden die IWF-Mitgliedschaft positiv bewerten. Standard & Poor’s Global habe den Beitritt ausdrücklich gelobt. Die Regierung sehe sich in der Pflicht, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Sie wolle sich nicht vorwerfen lassen, im Krisenfall dies nicht vorgelegt zu haben.
Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni ergänzt die aussenpolitische Perspektive. Als kleine, offene Volkswirtschaft sei Liechtenstein auf ein stabiles internationales Umfeld angewiesen. Der IWF stehe für internationale Zusammenarbeit. Die Quotenerhöhung leiste einen Beitrag zu einem globalen Sicherheitsnetz. Der IWF sei eine wichtige Plattform für Austausch. Er gebe den Zugang zu den Finanzministerien der Welt.
Der Landtag stimmt dem Finanzbeschluss mit 20 Ja-Stimmen bei 25 Anwesenden zu. Die Quote Liechtensteins beim IWF wird von 100 auf 150 Millionen Sonderziehungsrechte erhöht.