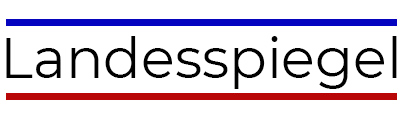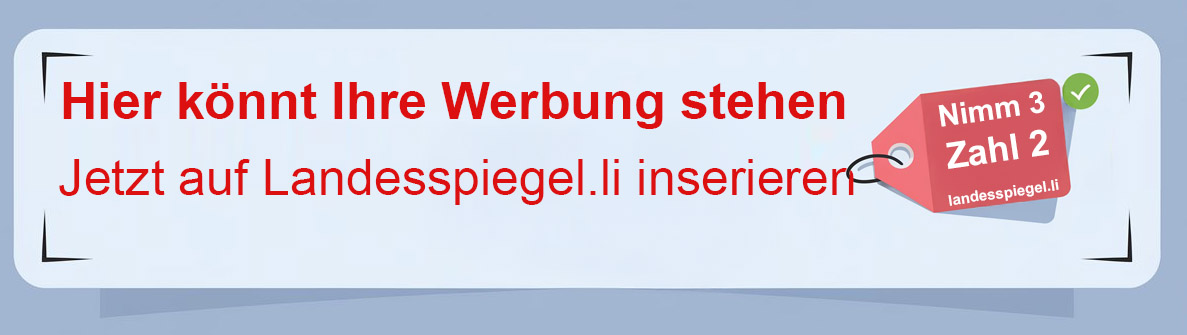Landtag debattiert über Verkehrsinfrastruktur: 20 Millionen Euro und viele offene Fragen

Regierungsrat Daniel Oehry im Landtag am 6.11.2025 | Foto: Gregor Meier
Der Verkehrsinfrastrukturbericht 2026 sorgte am 6. November im Landtag für intensive Diskussionen. Die Regierung plant, 20 Millionen Franken für den Strassenbau und Unterhalt zu investieren. Hinzu kommen 13 Millionen für den Industriezubringer Triesen und eine Million für die Nordeinfahrt beim Bahnhof Schaan.
Baustellen-Chaos sorgt für Unmut
Sebastian Gassner (FBP) sprach ein Problem an, das viele Bürger beschäftigt: die zahlreichen Baustellen. Er forderte bessere Koordination und stellte eine konkrete Frage: Könnte man wichtige Baustellen im Zwei- oder Drei-Schicht-Betrieb ausführen? Das würde die Bauzeit verkürzen und den Verkehr entlasten. Der volkswirtschaftliche Schaden durch lange Staus müsse bewertet werden, meinte Gassner.
Scharfe Kritik kam von Simon Schächle (DpL): Der Fortschritt bleibe hinter den Ansprüchen zurück. Das Mobilitätskonzept 2030 sei zehn Jahre alt – nun brauche es sichtbare Ergebnisse auf der Strasse. Projekte wie verschiedene Radwegverbindungen würden seit Jahren diskutiert, aber kaum vorangebracht.
Unterland fürchtet Verkehrskollaps
Für Patrick Risch (FL) fehlt im Bericht einen Abschnitt über den angestrebten Modal Split. «Wo wolle Liechtenstein beim Verkehr im Jahr 2030 stehen?«, fragte er. Vorarlberg habe sich klare Ziele gesetzt: Bis 2030 sollen mehr als 50 Prozent der Wege mit Bahn, Bus, Rad oder zu Fuss erfolgen.
Dietmar Hasler (VU) warnte vor den Auswirkungen des Stadttunnels Feldkirch. Der Bericht erwähne einen Zuwachs von täglich 1300 bis 1500 Fahrzeugen. Wie die Regierung die zusätzliche Attraktivität der Route Feldkirch-Haag als Transitstrecke beurteile, wollte Hasler wissen. Er regte an, dass das Land aktive Bodenpolitik betreiben solle, um bei künftigen Infrastrukturprojekten Handlungsmöglichkeiten zu haben.
Manuela Haldner-Schierscher (FL) wurde konkret: Mit der Inbetriebnahme des Stadttunnels Feldkirch im Jahr 2030 werde das Verkehrsaufkommen im Unterland massiv zunehmen. Heute verzeichne das Zollamt Schaanwald 10’000 Fahrzeuge pro Tag. Die Prognose sage für 2030 einen durchschnittlichen Tagesverkehr von 15’334 Fahrzeugen voraus – 50 Prozent mehr als heute.
Radverkehr: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Mehrere Abgeordnete betonten das Potenzial des Radverkehrs. Hasler nannte Kopenhagen als Vorbild. Haldner-Schierscher ergänzte, auch die Niederlande hätten bereits taugliche Lösungen gefunden. Man müsse das Rad nicht neu erfinden, nur über den Tellerrand schauen.
Carmen Heeb-Kindle (VU) begrüsste das neue digitale Informationssystem für Baustellen und Verkehr. Sie fragte, wie der aktuelle Stand der Erfassung durch die Gemeinden sei und wann das System der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde.
Triesen fordert Brücke
Gleich mehrere Triesner Abgeordnete nutzten die Debatte, um eine Fuss- und Radwegbrücke nach Wartau zu fordern. Thomas Rehak (DpL) sagte, Triesen verfüge über keine einzige Brücke. Er hoffe auf Unterstützung seiner Triesner Kollegen im Landtag. Marion Kindle-Kühnis (DpL), Thomas Vogt (VU), Carmen Heeb-Kindle (VU) und Daniel Salzgeber (FBP) schlossen sich der Forderung an.
Enteignungen: Heikles Thema
Das Thema Enteignungen sorgte für kontroverse Diskussionen. Gassner regte an, die Regierung solle doch einmal mit einem Enteignungsantrag an den Landtag gelangen. Wenn man Mut fordere, müsse man auch mutig sein und die Regierung unterstützen.
Dem widersprach Thomas Rehak deutlich: Das Verfahren müsse beim Landtag bleiben. Man solle an die Hochspannungsleitung denken. Wie es den Eigentümern erginge, wenn diese Rechte bei der Regierung lägen, könne man sich vorstellen.
Dagmar Bühler-Nigsch (VU) sah das anders. In der letzten Legislatur habe man genügend Erfahrungen gesammelt, wie entscheidungsfreudig der Landtag sei. Die Hochspannungsleitung habe man bereits zweimal verschoben. Eine Kompetenzübertragung an die Regierung für bereits bewilligte Projekte würde die Sache beschleunigen.
Minister Oehry nimmt Stellung
Infrastrukturminister Daniel Oehry erklärte ausführlich, wie die Baustellenkoordination funktioniere. Es gebe eine fünfjährige Planung der Baustellen, regelmässige Treffen mit den Gemeinden und zweimal jährlich Koordinationssitzungen der öffentlichen Bauherren.
Zum Thema Nachtarbeit sagte Oehry, man könne durchaus Pilotprojekte starten. Man müsse dann aber die Mehrkosten erheben und dem Landtag vorlegen. Bei einer Baustelle in Eschen hätten sich die Anwohner gegen längere Arbeitszeiten gewehrt – obwohl man drei Monate hätte einsparen können.
Zum Stadttunnel Feldkirch räumte Oehry ein, es gebe keine kurzfristige Lösung. Man müsse einen Teil der Pendler auf den öffentlichen Verkehr und den Radverkehr bringen. Der Rest werde auf der Strasse abgewickelt. Im Raum- und Mobilitätskonzept 2050 würden diese Fragen adressiert.
Zum Thema Enteignungen kündigte Oehry an, das Strassengesetz im ersten Quartal 2026 in die erste Lesung zu bringen. Dann könne der Landtag entscheiden, ob die Enteignungskompetenz teilweise an die Regierung übergehen solle. Zur Triesner Brücke sagte Oehry klar: Man brauche die Gemeinde Triesen, die eine Brücke wolle, und eine Schweizer Gemeinde auf der anderen Seite des Rheins. Dann könne man im Agglomerationsprogramm darüber reden und ein Projekt analog zu Ruggell machen.
Das Stimmungsbild im Landtag zeigte: Die Abgeordneten erwarten mehr Tempo bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten. Gleichzeitig bleiben viele Fragen offen – vor allem beim drohenden Verkehrskollaps im Unterland.