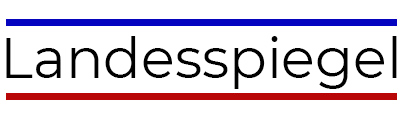Beat Jans spricht über die Zusammenarbeit im Justizbereich

Die deutschsprachigen Justizministerinnen und Justizminister haben sich zu ihrem regelmässigen Austausch getroffen, um gemeinsame Herausforderungen zu diskutieren und die justizielle Zusammenarbeit zu stärken. Neben multilateralen Themen standen auch bilaterale Fragen zwischen der Schweiz und Liechtenstein auf der Agenda – insbesondere die Aktualisierung eines seit über 50 Jahren bestehenden Abkommens zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen sowie Fortschritte bei der Digitalisierung der Justiz. Bundesrat Beat Jans schildert die Ergebnisse aus seiner Sicht:
Es ist immer sehr wertvoll, sich mit den Ministern der deutschsprachigen Länder austauschen zu können. Wir haben aktuelle Themen besprochen und positive Praxisbeispiele zum konkreten Nutzen der Bevölkerung ausgetauscht. Dabei haben wir mit Liechtenstein das Abkommen zur Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsurteilen aktualisiert. Das war nötig – solche Abkommen müssen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Sie haben sich bereits im August mit Regierungsrat Manuel Schädler getroffen und haben dort über die Digitalisierung in der Justiz gesprochen. Können Sie da etwas Konkretes sagen – wo sehen Sie da Potenzial, wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, hier ist konkret ein wichtiger Entscheid des Schweizer Parlaments gefasst worden. Es hat beschlossen, dass künftig der Rechtsverkehr digital abgewickelt werden soll. Das heisst, die Behörden, aber auch professionelle Nutzer sollen künftig digital miteinander kommunizieren. Für Bürgerinnen und Bürger ändert das nichts – die können nach wie vor weiterhin auch per Brief kommunizieren. Aber Anwaltsbüros sollen zukünftig digital kommunizieren. Wir glauben, dass das die Abläufe beschleunigt und effizienter macht. Wir können so viel Papier sparen und Bürokratie abbauen.
Wir arbeiten nun am Projekt «Justitia 4.0». Hier gilt es sicherzustellen, dass Liechtenstein diese Möglichkeiten auch nutzen kann.
Das Thema Asyl ist immer ein brennendes Thema für die Justizminister, in allen deutschsprachigen Ländern ein grosses Thema, auch in den Medien. Welche Impulse hoffen Sie sich hier von dem Austausch mit Ihren Kollegen?
Zu diesem Thema haben wir einen intensiven Austausch. Der Austausch funktioniert nicht nur auf Ministerebene, sondern auch auf technischer Ebene. Ich schätze es sehr, dass Hubert Büchel als neuer zuständiger Minister schnell das Gespräch gesucht hat.
Es ist wichtig, dass die Schengenstaaten ihre nationalen Asylverfahren im Griff haben. Diese müssen effizient, fair und gerecht sein. Wichtig ist, dass auch die europäische Politik, mit dem gemeinsamen Asyl- und Migrationspakt, der ab nächstem Jahr in Kraft tritt, wichtige Schritte macht. Die Schweiz und Liechtenstein, beides assoziierte Länder, müssen sich abstimmen, wie wir die entsprechenden Beschlüsse übernehmen können oder müssen.
Es ist wichtig, dass sich alle europäischen Länder solidarisch mit den Auffangstaaten in Süd- und Osteuropa zeigen. Dies, weil laut Dublin-Abkommen derjenige Staat ein Asylgesuch bearbeiten muss, in den eine Person zuerst eingereist ist.. Als Ausgleich dafür wollen sich die anderen Länder solidarisch zeigen. Der Bundesrat und das Parlament haben deshalb beschlossen, dass sich die Schweiz über diesen neuen Mechanismus an der Stärkung der Dublin-Zusammenarbeit beteiligt.
Gibt es darüber hinaus bilaterale Themen zwischen der Schweiz und Liechtenstein, über die Sie gesprochen haben?
Wir haben ein wichtiges Abkommen aktualisiert, das wir 1968 abgeschlossen haben – ein Abkommen, das sich bewährt hat. Aber nach 50 Jahren muss es der heutigen Zeit angepasst werden.
Das Problem war: Bei Schweizer Gerichtsurteilen in Zivilsachen gab es Gerichtskosten, die von einer unterliegenden Beklagten mit Wohnsitz in Liechtenstein nicht mehr eingefordert werden konnten – wegen einer per 2025 eingetretenen Änderung im nationalen Schweizer Recht. Das Abkommen entsprach nicht mehr der neuen Rechtslage in der Schweiz. Das haben wir jetzt korrigiert, weil sich verschiedene Kantone diesbezüglich beim Bundesamt für Justiz gemeldet haben. Sie sagten: Wenn Gerichtskosten in Liechtenstein anfallen, können wir die gar nicht einfordern. Das war ein Grund für die Anpassung.
Im umgekehrten Verhältnis hatte Liechtenstein das Problem unter dem geltenden Abkommen, dass die Rechtskraft bei zivilrechtlichen Urteilen durch das Gericht bestätigt werden musste, welches die Entscheidung gefällt hat. Gemäss dem liechtensteinischen Recht ist die Zuständigkeit aber anders geregelt, was zu Problemen bei der Vollstreckung in der Schweiz geführt hat. Das Bundesamt für Justiz hat in der Folge die Verhandlungen mit dem Fürstentum Liechtenstein auch zu diesem Aspekt aufgenommen. Dabei wurden noch weitere untergeordnete Punkte gelöst, insbesondere sprachlicher Natur.
Im Wesentlichen bedeutet das nun, dass Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen einfacher zu ihrem Recht kommen, wenn ein Prozess beide Länder betrifft. Und es geht darum, dass beide Länder ihre Gerichtskosten auch im anderen Land durchsetzen können. Das ist der wesentliche Inhalt, den wir heute aktualisiert haben. Ich bin sehr froh – auch hier ist das wieder sehr kooperativ gelaufen und sehr professionell auf beiden Seiten abgewickelt worden.
Ich möchte mich auch hier wieder sehr herzlich bedanken für diese gute Zusammenarbeit mit dem Fürstentum Liechtenstein.