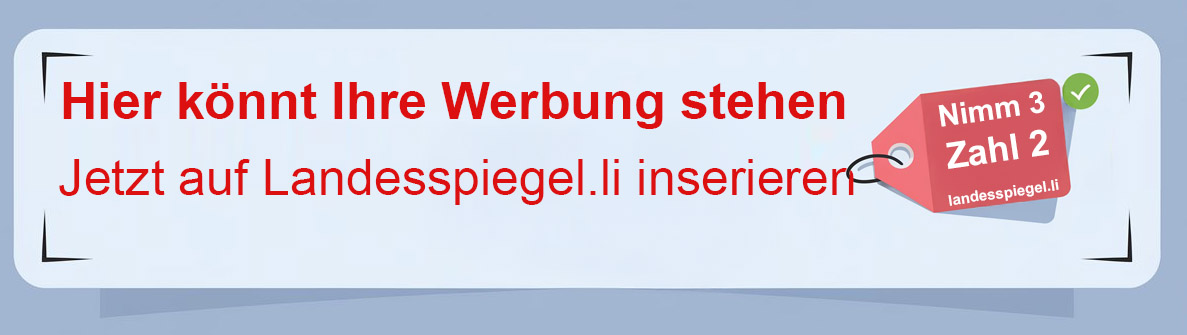Bei den Fern- und Nahwärmenetzen sind die Wärmeerzeugung und die Verbraucher oft weit voneinander entfernt. Ein Teil der eingespeisten Wärme geht beim Transport zum Verbraucher durch die kilometerlangen Rohre verloren. Diese Wärmeverluste hängen von der Anzahl angeschlossener Verbraucher bzw. deren Wärmeverbrauch pro km Netzlänge ab. Wärmenetze in Ballungszentren, mit vielen Anschlüssen pro km Netzlänge, haben prozentual weniger Verluste gegenüber denen in den verstreuten Einfamilienhaus-Siedlungen. Die unter der Strasse nutzlos verlorene Wärme, muss auch erzeugt werden. Im Jahr 2023 kaufte Liechtenstein Wärme für den Betrieb ihrer Wärmenetze 38.2 Mio. kWh Energie ein. Nur 29.6 Mio. kWh sind beim Endverbraucher angekommen (Geschäftsbericht 2023, S. 13). Dies ergibt einen Verlust von 22%. Im Erdreich verpufften somit 8.6 Mio. kWh. Damit könnte der Wärmebedarf von ca. 400 Einfamilienhäusern gedeckt werden.
Wärme Liechtenstein kaufte im Jahr 2023 für die Versorgung der Wärmenetze, nebst anderen Energieträgern, 14.7 Mio. kWh Gas ein. Ganze 38% der Wärme für die Wärmenetze wurde mit Gas erzeugt. Dies obwohl der Bevölkerung nahegelegt wurde, keine Gasheizung mehr einzubauen. Die zusätzlich zum Gas eingekaufte Wärme aus der Kehrichtverbrennung wird zu 48% aus fossilen Brennstoffen erzeugt.
Der Arbeitspreis für Nahwärme liegt bei 17.3 Rappen pro kWh, zuzüglich eines Leistungspreises. Dazu kommt noch Kosten für den Fernwärmeanschluss, der gemäss Energiebündel Liechtenstein für ein Einfamilienhaus CHF 35‘000 und für ein Mehrfamilienhaus CHF 55’000 kosten kann. Das Vergraben der Eisenrohre in den Strassen ist ebenfalls mit Kosten verbunden.
Das Vaterland wirft in der Samstagausgabe vom 8.2.2025 die Frage auf: Lohnt sich dies überhaupt?
Das muss jeder Hausbesitzer für sich selbst entscheiden. Eine Wärmepumpe stellt aus 1 kWh Strom 2.5 bis 4 kWh Wärme bereit. Anstatt den Strom aus PV-Anlagen zum Mindestpreis für 6 Rappen pro kWh ins Netz zu speisen kann damit 2.5 bis 4 kWh Wärme erzeugt werden.
Herbert Elkuch