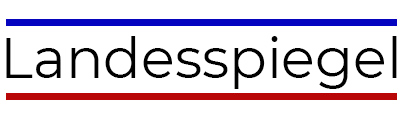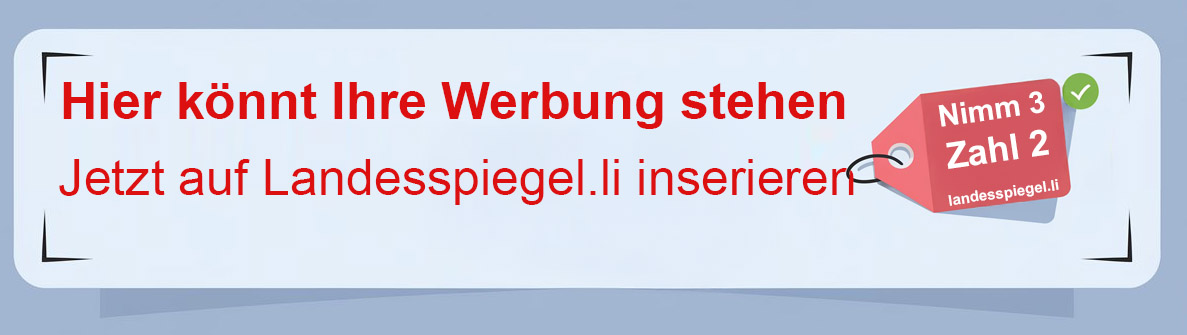Doppelter Pukelsheim: Schweizer Bericht befeuert liechtensteinische Reformdiskussion

Ein aktueller Bericht der Schweizer Bundeskanzlei zu Wahlsystemen, der gestern veröffentlicht wurde, könnte der Debatte um die Einführung des doppelten Pukelsheim neue Impulse geben. Die Analyse bewertet das doppeltproportionale Divisorverfahren nach Pukelsheim als mathematisch präzisestes System – ein Verfahren, das im Zentrum der von der FBP geforderten Wahlrechtsreform steht.
Das liechtensteinische Wahlrecht teilt das Land in zwei Wahlkreise – Ober- und Unterland. Diese Einteilung sorgt seit Jahren für Diskussionen. Denn eine Stimme im bevölkerungsstärkeren Oberland hat de facto mehr Gewicht als eine im Unterland. Kritiker sprechen von einem Demokratiedefizit, das die politische Gleichheit verletzt.
Genau hier setzt der Doppelte Pukelsheim an: Er verteilt die Sitze zunächst proportional auf die Parteien nach dem gesamten Landesergebnis und weist sie erst danach den Wahlkreisen zu. Damit würde jede Stimme gleich viel zählen – egal ob sie in Balzers oder in Ruggell abgegeben wird.
Der Bericht der Schweizer Bundeskanzlei bestätigt, was Befürworter auch in Liechtenstein seit Jahren betonen: Klassische Verfahren wie das Hagenbach-Bischoff-System (seit 1919 in der Schweiz im Einsatz) oder das Sainte-Laguë-Verfahren sind zwar bewährt, führen aber zu Verzerrungen. Der Doppelte Pukelsheim hingegen gilt als eines der fairsten Verfahren überhaupt. Die Bundeskanzlei hebt hervor, dass dieses Modell die mathematische Gleichwertigkeit der Stimmen am besten garantiert – ein Argument, das die FBP nun im eigenen Land aufgreift.
Gleichzeitig wird auf die grossen Implementierungsherausforderungen hingewiesen. Die Bundeskanzlei identifiziert die hohe Komplexität als wesentlichen Schwachpunkt des Systems. Die Mandatsberechnung erfordert iterative mathematische Verfahren, die nur mittels spezialisierter Software durchgeführt werden können und für Laien praktisch nicht nachvollziehbar sind.
Besonders problematisch sei die Transparenz auf Wahlkreisebene, wo die simultane Berücksichtigung von Partei- und Wahlkreisdivisoren die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse erheblich erschwert. Das könnte zu einer «Übertechnisierung» des demokratischen Prozesses führen, die das Vertrauen der Bevölkerung in die Integrität und Verständlichkeit des Wahlsystems untergraben könnte.
Chancen und Widerstände in Liechtenstein
Die FBP sieht im Doppelten Pukelsheim den Schlüssel zu mehr Gerechtigkeit im Wahlrecht. Insbesondere kleinere Parteien könnten profitieren, da ihre Stimmen nicht länger durch die starre Wahlkreislogik verwässert würden.
Doch es gibt Widerstand: Gegner warnen vor einem „zu komplizierten System“, das für die Bevölkerung schwer verständlich sei. Zudem befürchten manche, dass die jahrzehntelange Balance zwischen Ober- und Unterland politisch ins Wanken geraten könnte.
Ob Liechtenstein tatsächlich den Schritt wagt, bleibt offen. Klar ist: Der Schweizer Bericht liefert der Reformdebatte neue Argumente – und zeigt, dass die Diskussion nicht nur eine liechtensteinische Eigenheit ist.