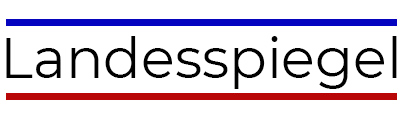Medienvielfalt – Wunsch oder Wirklichkeit?
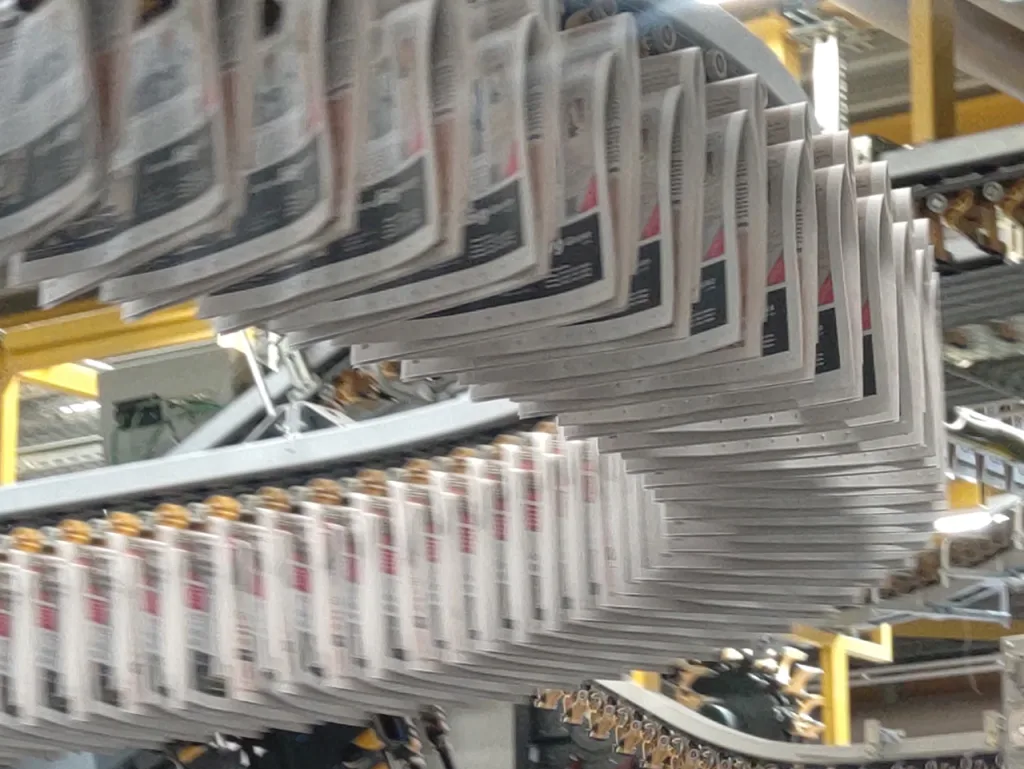
Immer wieder wird gesagt, dass die Medienvielfalt in Liechtenstein abnimmt. FBP-Parteipräsident Alexander Batliner schrieb diese Woche in seinem Blog „Fakt ist, wir brauchen mehr Medienvielfalt im Land.“
Ist das wirklich so? Was ist überhaupt Medienvielfalt? Fragen wir dazu einmal ChatGPT:
Medienvielfalt bedeutet, dass es viele unterschiedliche Medienangebote gibt – also verschiedene Zeitungen, Fernsehsender, Radiostationen, Online-Plattformen, Podcasts usw. – die unabhängig voneinander berichten und unterschiedliche Meinungen, Perspektiven und Themen darstellen.
Man kann den Begriff in zwei Dimensionen betrachten:
Angebotsvielfalt (quantitativ):
- Es existieren viele verschiedene Medienunternehmen und -produkte (z. B. ARD, ZDF, RTL, Spiegel, taz, YouTube-Kanäle usw.).
Meinungsvielfalt (qualitativ):
- In den Medien kommen unterschiedliche politische, kulturelle und gesellschaftliche Sichtweisen zu Wort. Ziel ist, dass sich Bürger sollen sich frei und umfassend informieren können.
Im Vergleich mit anderen Regionen – östlich und westlich von Liechtenstein – muss man einfach anerkennen, dass die Angebotsvielfalt nicht nur vorhanden ist, sondern sehr gross. Bei jeder Hundsverlocherten sind mindestens drei Medien anwesend. Manchmal sogar vier. So etwas gibt es weder in St. Gallen noch in Vorarlberg.
Anders sieht es mit der Meinungsvielfalt aus. Das politische Spektrum der zahlreichen Medien im Land widerspiegelt nun einmal die politische Grosswetterlage. Es gibt keine linke Zeitung in Liechtenstein. Diese wäre auch nicht wirtschaftlich tragfähig.
Die Stiftung Zukunft.li hat sich mit der Medienvielfalt im Land auseinandergesetzt und kürzlich in einem Positionspapier mehrere Vorschläge gemacht, wie die Medien gestärkt werden könnten.
Teilweise sind es gute und richtige Denkansätze, doch leider sind die meisten realitätsfremd und nicht fertig gedacht.
Einer dieser Vorschläge ist, die Medienförderung zu demokratisieren, indem bei der Steuererklärung angegeben wird, welches Medium unterstützt werden soll. Ein Teil der staatlichen Subvention sollte dann entsprechend dem „Wahlergebnis“ verteilt werden.
Wie soll ein Medienunternehmen planen, wenn man am Jahresbeginn nicht weiss, wie viel Budget man für das Jahr hat? Wieviel Mitarbeiter kann man beschäftigen, ohne bei einem unerwarteten Ausgang der „Abstimmung“ zu grosse Einbussen hat? Und natürlich müsste man dann die Redakteure dafür sensibilisieren, so zu schreiben, dass es die Leser möglichst gut finden und bei der Steuererklärung das eigene Medium ankreuzen.
Ganz abgesehen von der Frage, welcher Journalist, würde bei einem Medium arbeiten, bei dem die finanzielle Situation derart unplanbar ist, dass man jedes Jahr bei der Veröffentlichung des Ergebnisses um seinen Job zittern muss? Vermutlich werden es nicht die Besten sein, die eine Wahl haben und bei einem anderen Medium oder in einer anderen Branche ein Angebot hat.
Einig sind sich wohl die Meisten, dass die Meinungsvielfalt und dass verschiedene Meinungen publiziert und verbreitet werden, insbesondere in einer direkten Demokratie, von elementarer Wichtigkeit ist. Das sieht auch die Stiftung Zukunft.li so.
Unklar bleibt die Auslegung. Immer wieder wird kritisiert, dass das Vaterland der VU gehöre und dass das ein Problem ist. Da muss man einfach einmal klar sagen: Nein das ist kein Problem!
Die VU darf, wie jede andere Partei, so viele oder so wenige Zeitungen besitzen, wie sie möchte: Eine, drei oder null. Man kann es der VU einfach nicht vorwerfen, dass andere Parteien sich für null entschieden haben. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn dies Medium mit der grössten Reichweite nicht über eine Stiftung an der stärksten Partei hängt. Aber es zu verkaufen, wie es die Stiftung Zukunft.li vorschlägt, ist wieder nicht zu Ende gedacht.
Ich bin sicher, dass es Unternehmen oder Einzelpersonen in Liechtenstein oder im Ausland gibt, die das Medienhaus kaufen würden. Doch was bedeutet das? Wenn eine Einzelperson die Zeitung besitzt, kann sie damit mehr oder weniger machen, was sie will. Die Vorstellung, dass dieser Medienmessias einzig und allein der Meinungsfreiheit, Neutralität und anderen höheren Werte verschreibt, ist wohl illusorisch. Jemand, der eine Zeitung kauft, will damit entweder Geld verdienen oder er verfolgt ein politisches Ziel. Beides vollkommen legitim. Eine Partei, egal welche, ist aber auch in sich ein demokratisches Gebilde, besonders Volksparteien wie die VU oder die FBP, mit breiten ideologischen Spektren, sodass es schon dort Meinungspluralität und Kontrollfunktionen gibt.
Selbst, wenn das Medienhaus an einen Privatinvestor verkauft wird. Ein indirekter Einfluss bleibt den Regierungsparteien immer erhalten. Denn die Mehrheit im Landtag kann die Medienförderung jederzeit kürzen oder streichen – wenn sie will, auch mit 13 Tagen Vorlaufzeit.
Wie könnte die Lösung ausschauen?
Eine nachhaltige Lösung für mehr Medienvielfalt in Liechtenstein muss zwei Dinge gleichzeitig leisten: Planungssicherheit für die bestehenden Medien schaffen und Raum für neue, unabhängige Stimmen eröffnen. Beides lässt sich nur erreichen, wenn man Medienpolitik nicht als kurzfristiges Förderinstrument versteht, sondern als Teil der demokratischen Infrastruktur.
Ein möglicher Weg wäre, eine medienunabhängige Förderinstanz zu schaffen – ähnlich wie in anderen europäischen Ländern. Diese könnte nach klar definierten, transparenten Kriterien Fördergelder vergeben: etwa für investigativen Journalismus, Regionalberichterstattung, digitale Innovation oder journalistische Weiterbildung. Damit würde der Staat nicht Inhalte, sondern die Rahmenbedingungen fördern. Wichtig wäre dabei: politische Neutralität, klare Kriterien und eine mehrjährige Finanzierungsplanung.
Gleichzeitig darf diese staatliche Förderung nicht derart wettbewerbsverzerrend sein, dass es den Eintritt neuer Medienunternehmen verunmöglicht. Denn nur der Wettbewerb unter den Medien sichert deren Qualität.