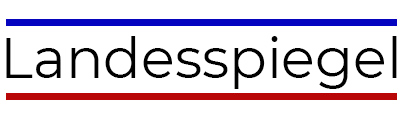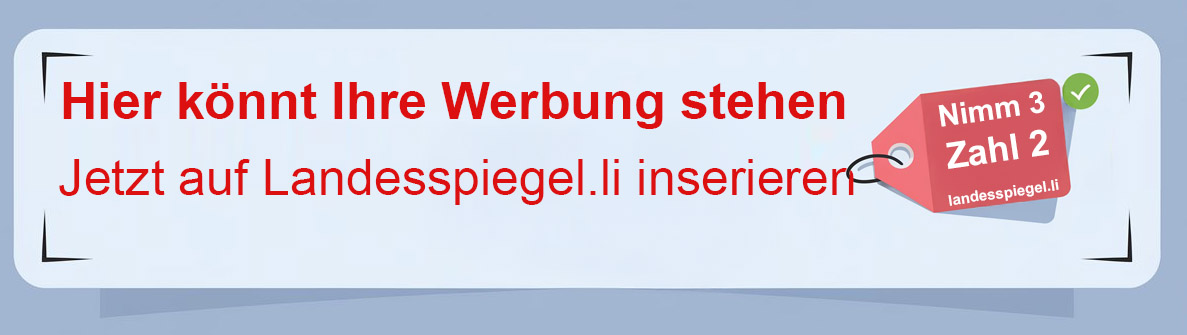Obergericht verschärft Urteil im millionenschweren Betrugsfall

Innenaufnahmen vom Verhandlungssaal 1 | Bildquelle: Fürstliches Landgericht
Das Fürstliche Obergericht hat gestern den Schlussstrich in einem Strafverfahren abgeschlossen, in dem bereits seit 2018 ermittelt wird. Das Urteil gegen einen österreichischen Anwalt wurde verschärft. Der Anwalt, der eine Beratungsfirma in Liechtenstein betrieb, hatte zusammen mit einem Deutschen mehrere Privatpersonen und Firmen in Liechtenstein geschädigt. Der Deutsche wurde bereits im Jahr 2022 rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt.
Im November 2024 wurde der Angeklagte vom Kriminalgericht wegen versuchten und teilweise vollendeten schweren Betrugs – teils als Beitragstäter – sowie wegen Geldwäscherei verurteilt worden. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, wovon ein Jahr bedingt für eine Probezeit von drei Jahren nachgesehen wurde. Gegen dieses Urteil legte der Angeklagte Berufung ein. Auch die Staatsanwaltschaft war mit dem Urteil nicht einverstanden und erhob ihrerseits Berufung.
Im Kern ging es darum, dass der österreichische Anwalt im bewussten Zusammenwirken mit dem Deutschen potenzielle Investoren und Darlehensgeber täuschte, indem er ihnen glaubhaft machte, dass die einbezahlten Gelder sicher und rückzahlbar seien – obwohl von Anfang an geplant war, diese missbräuchlich zu verwenden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 1,8 Millionen Franken.
Begonnen hatte alles im Jahr 2017, als Investoren und Darlehensgeber keine Rückzahlungen mehr erhielten. 2018 gingen erste Anzeigen ein, weitere folgten 2019.
Die Verteidigerin des Angeklagten argumentierte in der Berufung, dass eine materielle Nichtigkeit vorliege, da das Gericht keine zutreffenden Feststellungen hinsichtlich des Vorsatzes getroffen habe. Zudem seien Milderungsgründe – wie die überlange Verfahrensdauer und das Wohlverhalten des Angeklagten – nicht ausreichend berücksichtigt worden. Auch seien Beweisanträge ignoriert worden. Sie forderte einen Freispruch.
Die Staatsanwaltschaft hingegen vertrat die Auffassung, dass eine teilbedingte Strafe hier nicht möglich sei, da die entsprechende gesetzliche Bestimmung eine solche nur in besonderen Ausnahmefällen zulasse – ein solcher liege nicht vor. Zudem sei angesichts des hohen Schadens das Strafmass zu niedrig ausgefallen.
Der Angeklagte beteuerte erneut, er habe niemanden schädigen wollen. Vielmehr sei er selbst auf den deutschen Hochstapler hereingefallen und sehe sich als Opfer. Er habe schliesslich auch eigene Mittel zur Schadenswiedergutmachung aufgewendet.
Das Obergericht folgte diesen Ausführungen nicht, wies die Berufung des Angeklagten ab und gab der Berufung der Staatsanwaltschaft statt. Das Strafmass wurde auf dreieinhalb Jahre ohne Bewährung erhöht.
Zur Begründung erklärte der Senat, dass keine Zweifel an der Richtigkeit des Schuldspruchs bestehen. Die vom Kriminalgericht abgelehnten Beweisanträge betrafen einen Zeugen, der einzig hätte aussagen können, von wem die Idee zum Betrug stammte – das sei jedoch unerheblich. Massgeblich sei, dass die beiden Angeklagten in bewusstem Zusammenwirken agierten.
Wesentlich sei, dass sie den Investoren und Darlehensgebern gemeinsam glaubhaft machten, dass ihre Eigenkapitaleinzahlungen sicher seien – obwohl von Beginn an geplant war, diese missbräuchlich zu verwenden. Wer die Idee dazu hatte, sei dabei nicht entscheidend.
Der Vorsitzende führte aus, dass der Angeklagte bereits seit neun Jahren mit dem Deutschen zusammenarbeitete und bei entsprechenden Besprechungen anwesend war. Einen Scheck einer chinesischen Bank über einen Millionenbetrag habe er selbst weitergeleitet. Eine Bestätigung der Echtheit dieses Schecks habe er laut eigener Aussage auf einer Autobahnraststätte von einem Unbekannten erhalten.
Die Gesellschaft, deren Verwaltungsrat der Angeklagte war, verfügte nicht einmal über ein Bankkonto. Ihm musste daher klar sein, dass diese Gesellschaft niemals in der Lage gewesen wäre, die einbezahlten Gelder zurückzuzahlen. Zudem hatte er Freistellungsschreiben unterzeichnet, die dem Deutschen erlaubten, auf die Gelder zuzugreifen.
Der Angeklagte habe den Geschädigten mehrfach zugesichert, dass das Geld sicher sei, sie zur Zahlung gedrängt und den Deutschen als seriös dargestellt – obwohl er längst hätte wissen müssen, dass dies nicht zutraf. Erst als die ersten Anzeigen gegen den Deutschen eingingen, habe er erklärt, dieser sei wohl ein Betrüger. Es sei daher eindeutig, dass beide in bewusster Zusammenarbeit handelten.
Die Frage des Eventualvorsatzes sei anhand der Gesamtumstände zu beurteilen. Es sei festzustellen, dass es dem Angeklagten zumindest gleichgültig gewesen sei, ob die Geschädigten ihr Geld zurückerhielten oder nicht. Auch aus der Tatsache, dass der Angeklagte den Deutschen als Anwalt im Zusammenhang mit einem Zeitungsartikel in Deutschland vertreten habe, ergebe sich, dass er wusste, dass dieser nicht seriös war.
Trotzdem habe er weitergemacht und die Geschädigten weiterhin zu Zahlungen gedrängt. Die vom Angeklagten behauptete Schadenswiedergutmachung habe tatsächlich nie stattgefunden – vielmehr handle es sich um blosse Behauptungen, die mit gefälschten Dokumenten gestützt wurden.
Zur Strafhöhe führte der Senat aus, dass – entgegen der Feststellungen des Kriminalgerichts – kein untergeordneter Beitrag des Angeklagten vorliege. Vielmehr sei er als Mittäter zu beurteilen. Ohne seine Mitwirkung wären die Taten nicht möglich gewesen. Eine von ihm behauptete proaktive Aufklärung habe ebenfalls nicht stattgefunden. Lediglich durch den Verkauf beschlagnahmter Fahrzeuge und einer Immobilie sei ein Teil des Schadens gedeckt worden.
Da der Angeklagte bereits 2016 verurteilt worden war – damals wegen Veruntreuung von Kundengeldern – und innerhalb der Bewährungsfrist erneut straffällig wurde, sei ein Erschwerungsgrund aufgrund des schnellen Rückfalls gegeben. Eine bedingte Strafe sei somit ausgeschlossen. Das Strafmass wurde auf dreieinhalb Jahre unbedingt festgesetzt.