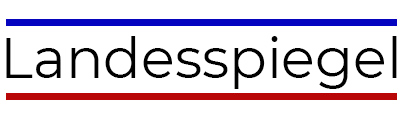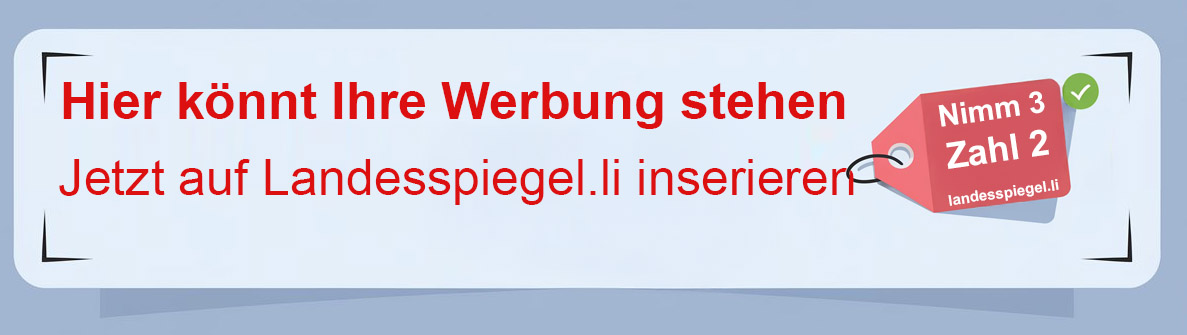Tribalismus und die Demokratie – eine gefährliche Entwicklung
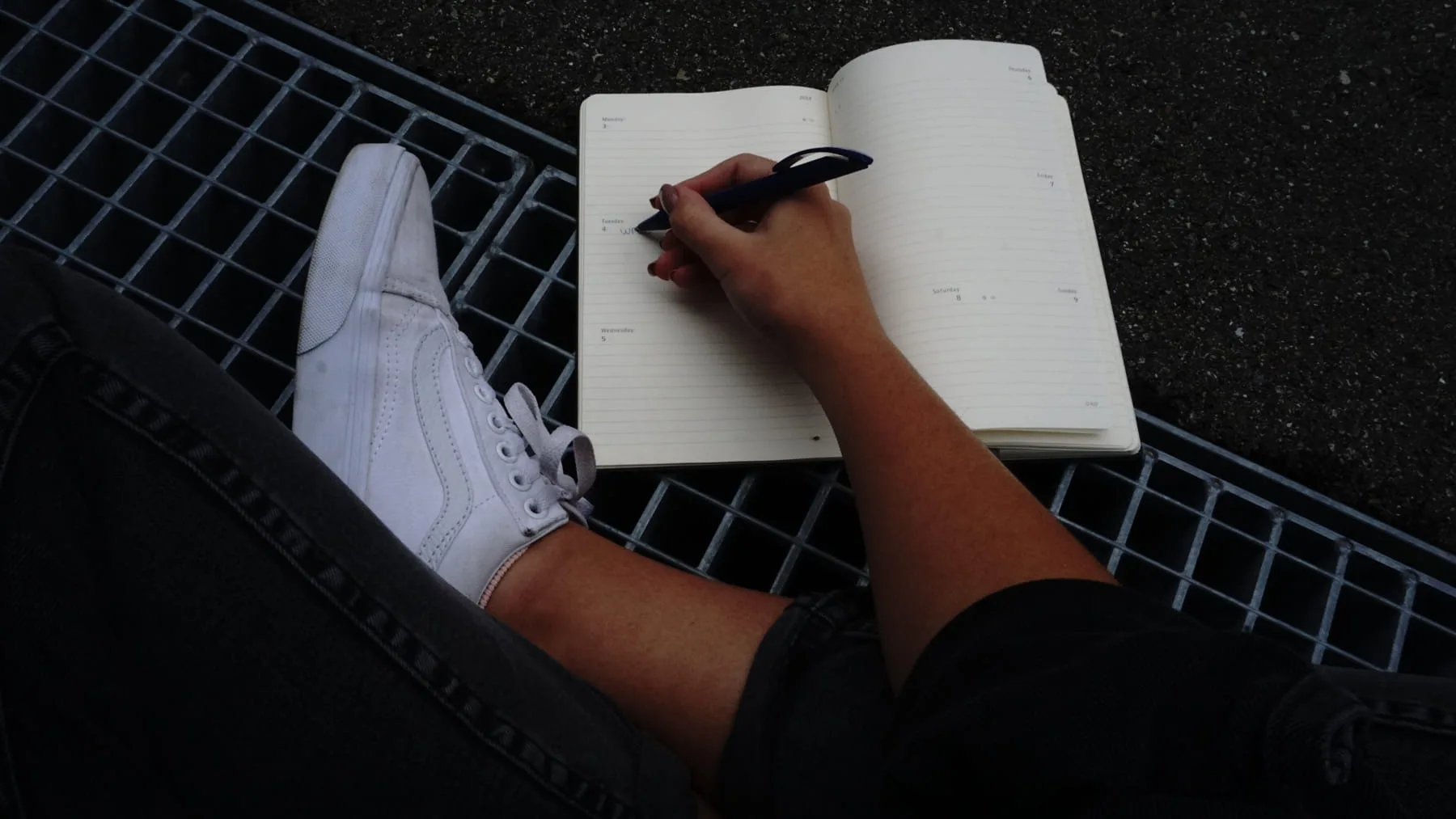
Ich stelle fest, dass der aktuelle Zulauf zur AfD zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen ist, dass sie von vielen als einzige konsequente Gegenposition zur grünen Politik wahrgenommen wird. Diese Entwicklung ist weniger das Ergebnis einer radikalisierten Wählerschaft als vielmehr die Folge einer verengten politischen Debatte, in der Kritik an bestimmten ideologischen Leitlinien – insbesondere in den Bereichen Klima-, Migrations- und Identitätspolitik – oft moralisch delegitimiert statt sachlich diskutiert wird.
Die reflexhafte Forderung nach Verboten oder einer „Brandmauer“ ist nicht nur politisch hilflos, sondern auch inhaltlich kurzsichtig. Ein Mehrparteiensystem lebt von der Auseinandersetzung, nicht von der Ausgrenzung. Wer glaubt, Wählerinnen und Wähler durch moralisierende Narrative, selektives Framing und den medialen Bias gegen unliebsame Meinungen umerziehen zu können, ignoriert die Realität: Die AfD wird nicht trotz, sondern gerade wegen dieser Mechanismen stärker.
Im europäischen Vergleich ist die AfD kein aussergewöhnliches Phänomen. Dass sie in zentralen Politikfeldern wie Migrationspolitik und Europapolitik die höchsten Kompetenzwerte erhält und auch in anderen Bereichen wie Kriminalitätsbekämpfung, Fiskalpolitik, Bürokratieabbau und Bildungspolitik weit vorne liegt, sollte nicht Empörung auslösen, sondern eine ernsthafte Reflexion darüber, warum die etablierte Politik hier so viel Vertrauen verspielt hat.
Wer eine Demokratie erhalten will, muss politische Konflikte führen, nicht verbieten.
Tribalismus als demokratische Gefahr
Ein entscheidender Faktor in dieser Entwicklung ist der zunehmende Tribalismus (von tribe = Stamm): Menschen identifizieren sich zunehmend über ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen, kulturellen oder politischen Gruppe und betrachten Andersdenkende nicht mehr als politische Gegner, sondern als Feinde. In der politischen Debatte bedeutet das, dass Parteizugehörigkeit oder ideologische Gruppierungen wichtiger werden als rationale Argumente, Fakten oder gemeinsame gesellschaftliche Werte.
Tribalismus gefährdet die Demokratie in mehrfacher Hinsicht:
• Er verstärkt die Polarisierung, indem er Menschen in starre Lager zwingt.
• Er untergräbt Objektivität und erschwert sachliche Debatten.
• Er reduziert politische Entscheidungsfindung auf die Frage, welche Gruppe „gewinnt“, anstatt nach den besten Lösungen für die Gesellschaft zu suchen.
Eine lebendige Demokratie kann jedoch nur existieren, wenn Offenheit, Toleranz und die Bereitschaft bestehen, über Gruppenidentitäten hinauszublicken und gemeinsame Lösungen zu finden.
Was dagegen getan werden kann
Um Tribalismus entgegenzuwirken, braucht es gezielte Massnahmen:
1 Förderung von kritischem Denken und Medienkompetenz: Bürgerinnen und Bürger sollten ermutigt werden, unterschiedliche Informationsquellen zu nutzen und Argumente sachlich zu bewerten, anstatt sich von emotionalen Narrativen leiten zu lassen.
2 Stärkung demokratischer Institutionen: Eine unabhängige Justiz, freie Medien und Bildungsinstitutionen sind essenziell, um Manipulation und Spaltung entgegenzuwirken.
3 Förderung von Dialog und Kompromissbereitschaft: Demokratie funktioniert nur, wenn verschiedene Gruppen miteinander reden, anstatt sich in ihren Echokammern gegenseitig zu bestärken.
Die Verantwortung der Politik – und ein Blick nach Liechtenstein
Gerade in Zeiten zunehmender Spaltung kommt Politikerinnen und Politikern eine besondere Verantwortung zu: Sie müssten eigentlich als Vorbilder vorangehen, indem sie sachlich argumentieren, echte Lösungen erarbeiten und die Debattenkultur pflegen. Doch ist das in Deutschland noch gegeben?
Zu oft erleben wir das Gegenteil: Moralisierung statt Argumente, Empörung statt Lösungen.
Liechtenstein mag ein kleines Land sein, doch es kann aus diesen Entwicklungen wichtige Lehren ziehen. Politische Debatten sind dort oft pragmatischer, weniger ideologisch aufgeladen und stärker an realen Lösungen orientiert. Es lohnt sich, den Unterschied zu betrachten:
Während in Deutschland politische Lager zunehmend verhärten und sich durch Tribalismus gegenseitig blockieren, zeigen Demokratien mit ausgeprägten Volksentscheiden und Mitbestimmungsrechten, wie in der Schweiz und in Liechtenstein, eine andere Dynamik. Dort ermöglicht die direkte Demokratie den Bürgerinnen und Bürgern, aktiv an politischen Entscheidungen teilzunehmen, was zu einer Kultur des Dialogs und der Kompromissbereitschaft beiträgt. Studien deuten darauf hin, dass die häufigen Volksabstimmungen in der Schweiz dazu beitragen, dass sich emotionale Spannungen zwischen politischen Lagern abbauen und die demokratischen Konfliktlösungsmechanismen weiterhin funktionieren.
Zudem spielt das Bildungssystem eine wesentliche Rolle. In der Schweiz und in Liechtenstein wird grosser Wert auf politische Bildung und Medienkompetenz gelegt, was die Bürgerinnen und Bürger befähigt, informierte Entscheidungen zu treffen und unterschiedliche Standpunkte zu verstehen. Diese Kombination aus direkter demokratischer Teilhabe und einem starken Bildungssystem fördert eine politische Kultur, die weniger von Polarisierung geprägt ist und stattdessen den Fokus auf sachliche Debatten und gemeinsame Lösungen legt.
Diese Beobachtungen sollten nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Anlass zur Reflexion geben. Es zeigt sich, dass die Stärkung direkter demokratischer Instrumente und die Förderung von Bildung und Medienkompetenz entscheidende Faktoren sein können, um Tribalismus entgegenzuwirken und die Demokratie zu beleben.
Daniel Lathan
Pressesprecher und Mitglied des Vorstands MiM-Partei