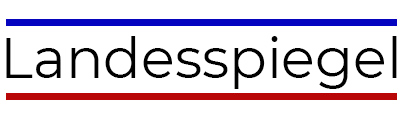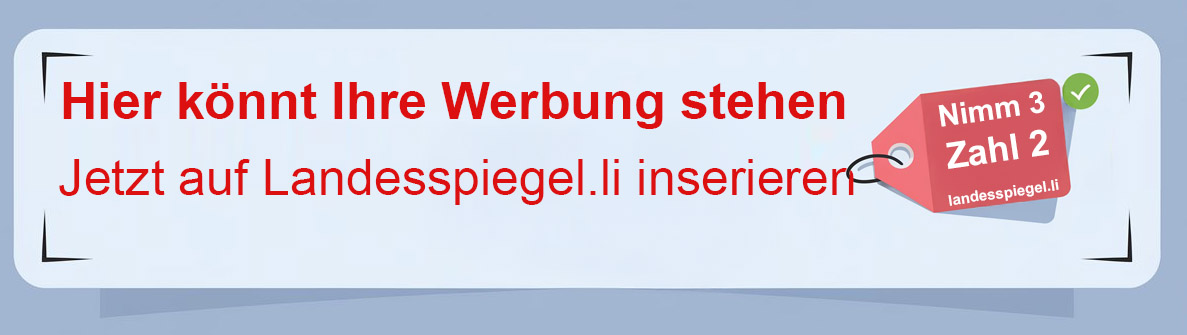Falschgeld-Prozess vor dem Landgericht

Unter grossem Polizeiaufgebot wurde gestern vor dem Fürstlichen Landgericht das Strafverfahren gegen zwei italienische Staatsbürger verhandelt. Laut Anklagevorwurf sollen sie im August dieses Jahres Falschgeld nach Liechtenstein gebracht haben. Die Angeklagten, in der Nähe von Mailand ansässig waren, sollen laut Anklage gemeinsam nach Prag gereist sein, um dort mehrere Taschen in Empfang zu nehmen. Diese Taschen enthielten 3’855 gefälschte 200-Euro-Banknoten – eine beträchtliche Summe von 771’000 Euro sowie eine Geldzählmaschine und eine UV-Lampe. Bei der Grenzkontrolle in Ruggell wurden die gefälschten Banknoten von Schweizer Grenzwachbeamten entdeckt sichergestellt. Seitdem befanden sich die Angeklagten in Untersuchungshaft in Vaduz. Zusätzlich wurde dem Erstangeklagten vorgeworfen, einen gestohlenen Ausweis bei sich gehabt zu haben.
Die Verhandlung
In der Schlussverhandlung vor dem Kriminalgericht wurden verschiedene rechtliche Aspekte beleuchtet. Der Erstangeklagte behauptete, nichts von den Hintergründen des Ausflugs gewusst zu haben. Der Zweitangeklagte gab an, dass ihm der Auftraggeber lediglich gesagt habe, er solle eine Person abholen, ohne Kenntnis von Falschgeld zu haben. Eine rechtliche Frage, die von entscheidender Bedeutung war, war die Qualifizierung der gefälschten Banknoten, auf denen das Wort «Faksimile» aufgedruckt war.
«Er hat mir gesagt, ich habe dir früher auch geholfen, jetzt erwarte ich einen Gefallen von dir»
Der Zweitangeklagte
Die Angeklagten bekannten sich nicht schuldig. Der Erstangeklagte behauptete zunächst, die meiste Zeit der Fahrt geschlafen zu haben und wenig über die Reise gewusst zu haben. Ausserdem hätte er aus seinen früheren Vorstrafen gelernt.
«Ich möchte mein Bestes geben und keine Fehler mehr machen»
Der ERstangeklagte
Der Zweitangeklagte gab an, von einem gewissen Johnny den Auftrag erhalten zu haben, eine Person abzuholen, ohne Details zu kennen. Unterwegs seien sie nach Prag gekommen, wo ihm ein Bündel Falschgeld gezeigt wurde. Er habe sich dazu überreden lassen, da ihm versichert wurde, dass der Transport solcher Noten in Italien legal sei. Aus seiner Sicht waren es höchstens zwei bis drei Tausend Euro. Für die Staatsanwältin unglaubwürdig, denn allein ein Bündel enthielt laut Landespolizei bereits 14’000 Euro an gefälschten Banknoten.
«Ich bin nicht in der Lage, im Internet etwas zu suchen»
Der ERstangeklagte
Ein Polizeibeamter der Kriminaltechnik, der die gefälschten Banknoten untersuchte, stellte fest, dass es sich um Totalfälschungen handelte. Die Sicherheitsmerkmale seien nachgemacht, jedoch nicht funktional. Die Banknoten könnten für einen Laien aus der Ferne dennoch als echt erscheinen.
«Der Aufdruck Faksimile ist für mich nur ein Milchbübletrick»
Der Zeuge
Die Schlussplädoyers
Die Staatsanwältin ist überzeugt von der Überführung der Angeklagten. Sie sieht den objektiven Tatbestand als erfüllt an, basierend auf der auffälligen Ähnlichkeit zu echten Banknoten. Ihrer Meinung nach muss Falschgeld dazu bestimmt sein, von einem arglosen Dritten für echt gehalten zu werden, und sie argumentiert, dass diese Absicht durch die nachgeahmten Sicherheitsmerkmale, die ähnliche Farbgebung sowie die exakte Form im Vergleich zu echten 200-Euro-Banknoten gegeben ist.
Die Aussagen der Angeklagten hält die Staatsanwältin für unglaubwürdig. Insbesondere bezweifelt sie die Glaubhaftigkeit des Erstangeklagten, der behauptet hatte, während der Fahrt grösstenteils geschlafen zu haben. Diese Aussage stehe im Widerspruch zu seiner zuvor getätigten Aussage in der Verhandlung, dass er fast ausschliesslich geschlafen habe. Die Staatsanwältin betont die Lebensfremdheit der Vorstellung, dass man gemeinsam über einen längeren Zeitraum im Auto sitzt, ohne zu fragen, worum es eigentlich geht.
Die Verteidigerinnen der Angeklagten, beide Verfahrenshelferinnen, plädierten vehement für einen Freispruch. Die Verteidigerin des Erstangeklagten legte dar, dass ihr Mandant nicht wusste, worum es bei der Reise ging, oder bestenfalls davon ausging, dass es lediglich darum ging, eine Person abzuholen. Dies allein sei nicht strafbar. Sollte das Gericht dies anders sehen, betonte sie, dass der Tatbeitrag ihres Mandanten äusserst untergeordnet sei. Der Erstangeklagte habe sämtliche Kontakte gehabt, die Initiative ergriffen, das Auto organisiert und mit den Männern in Prag verhandelt.
Die Verteidigerin des Zweitangeklagten führte an, dass die Banknoten nicht als Falschgeld zu qualifizieren seien, dies basierend auf dem Aufdruck «Faksimile» und der deutlich anderen Haptik im Vergleich zu echten Banknoten. Sollte das Gericht jedoch die objektiven Voraussetzungen für Falschgeld erfüllt sehen, argumentierte sie weiter, sei ihr Mandant davon ausgegangen, dass dies in Italien legal sei. In diesem Fall liege jedenfalls ein Tatbestandsirrtum vor, der ihm nicht vorzuwerfen sei, und er müsse freigesprochen werden.
Das Urteil
Nach einer Beratung von etwa einer halben Stunde verkündete das Kriminalgericht das Urteil, das die zwei Berufsrichter gemeinsam mit den drei Kriminalrichterinnen gefällt hatten.
Beide Angeklagte wurden für schuldig befunden. Der Zweitangeklagte erhielt eine Freiheitsstrafe von 27 Monaten, während der Erstangeklagte zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt wurde.
Der Vorsitzende erläuterte in seiner Begründung, dass, obwohl nur Indizien vorlägen, die Indizienkette geschlossen sei und daher zweifelsfrei von der Schuld der Angeklagten ausgegangen werden könne. Nach Auffassung des Gerichts seien die im Gerichtssaal ausgestellten 3’855 Banknoten durchaus dazu geeignet, bei einem arglosen Dritten den Anschein von echten Geldscheinen zu erwecken. Insbesondere bei sogenannten Rip-Deals, die im Verborgenen, beispielsweise in Restaurants, stattfinden würden, könnten die Opfer nicht jeden Geldschein überprüfen und den Aufdruck leicht übersehen. Die Tatsache, dass DNA-Spuren gesichert wurden, die zu einer Person gehören, die laut Interpol Österreich im Verdacht stehe, an solchen Rip-Deals beteiligt gewesen zu sein, sowie das Auftauchen der gleichen Seriennummern bei solchen Geschäften, deuten laut dem Vorsitzenden darauf hin, dass die Banknoten für derartige betrügerische Transaktionen bestimmt waren. Somit wäre die objektive Tatseite erfüllt.
Der Vorsatz des Zweitangeklagten sei laut dem Urteil klar erkennbar, insbesondere durch die Auswertung der Kurznachrichten. Die widersprüchlichen Aussagen der Angeklagten wurden als unglaubwürdig eingestuft. Hinsichtlich des Erstangeklagten sei laut Gericht nicht zu glauben, dass er bei einer so langen Fahrt nicht gewusst habe, worum es geht. Dennoch erkannte das Gericht an, dass sein Tatbeitrag geringer war als der des Zweitangeklagten, weshalb ihm eine Haftstrafe von 21 Monaten auferlegt wurde.
Die Blüten und Utensilien wurden konfisziert und der Landespolizei zu Schulungszwecken übergeben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sowohl die Verteidigerinnen als auch die Staatsanwältin gab keine Rechtsmittelerklärung ab. Es gilt die Unschuldsvermutung.